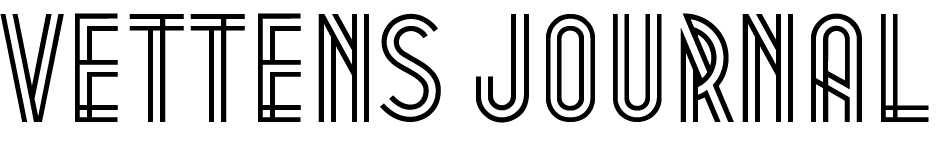HUNDELEBEN
sommer zwanzichfuffzehn XXVI
Bruno, der Chef vom Kiez. Pockennarbiges Gesicht. Schnell mit den Fäusten zur Stelle. Bruno hatte einen krummen Rücken, weil er wegen seiner Größe immer das Gefühl hatte, er müsse sich bücken. Als Krohn den Riesen von der Spree kennen lernte, war der in Trauer. Er zeigte jedem ein knittriges Foto, das Clint zeigte: einen rostfarbenen Zottelhund, dessen Schnauze Bruno gerade mal an die Waden reichte.
Clint und sein Herr waren ein Team gewesen, nachdem der vor einem Dutzend Jahren seine letzte Strafe abgerissen hatte. Der Hund war mit frechem Selbstbewusstsein durch Berlins Straßen getrottet, Bruno hatte sich nicht um die Menschen gekümmert, die ihn angafften. Sie hatten nur geguckt, aber nichts gesagt. Hatten nicht gewagt, sich über diesen schrägen Vogel lustig zu machen.
Er trug von März bis Ende Oktober kurze Hosen und hatte tagein, tagaus eine gestrickte Matrosenmütze. Bruno war nicht ohne seinen Rucksack – ein unförmiges Teil aus altem, verschmutztem Leinen – zu denken.
Manchmal hatte sich ein Tourist ein Herz gefasst und gefragt, ob er Bruno und seinen Hund fotografieren dürfe. Dann hatte Bruno die Hand aufgehalten, sich förmlich für eine kleine Spende bedankt und fürs Bild posiert. Clint hatte sich zu diesem Anlass auf den Hintern gesetzt und die Vorderpfoten nach vorne ausgestreckt, das hatte putzig ausgesehen.
Bruno und sein Hund waren scheinbar planlos durch die Stadt gestromert. Doch sie hatten schon gewusst, was sie taten. Nach dem Frühstück hatten sie einen Spaziergang zu einer Adresse gemacht, wo man mittags verköstigt wurde. Dann hatten sie sich gemächlich im großen Bogen treiben lassen. Am frühen Abend hatten sie den Hinterhof eines Supermarkts angesteuert und Köstlichkeiten aus den Containern gefördert.
Mit gefülltem Rucksack war Bruno bei den Freunden an der Spree eingelaufen. Jeden Abend großes Hallo. Man hatte es sich gemütlich gemacht. Jeder hatte die eine oder andere Flasche beisteuern können.
Einen Anlass zu feiern hatte man immer gefunden. Bruno hatte seine Köstlichkeiten verteilt, man hatte geschnattert und diskutiert, gelacht und gestritten. Neue waren dazu gekommen, Schwächlinge wegen Trunkenheit ausgefallen. Bruno hatte nie zu denen gehört, die die Segel strichen.
Bruno hatte auf seiner Bank gesessen, mit roten Knien und strammen Beinen in den dreckstarrenden kurzen Hosen. Er hatte gelächelt und war sich seiner Riesenhaftigkeit wohlig bewusst gewesen.
Und zu seinen Füßen hatte sich Clint eingeringelt und unbeeindruckt gepennt. Clint hatte nicht getrunken. Aber er war auch kein Spielverderber gewesen.
Am nächsten Morgen hatte Clint seinem Freund Bruno die feuchte Schnauze auf die Wange gedrückt. Der hatte langsam die Augen auf gekriegt, den Schnauzer des Hundes gesehen – und schon war es ein guter Tag gewesen.
Als Hans Krohn Bruno zum ersten Mal traf, war Clint gerade mal drei Wochen unter der Erde. Bruno, dieser Baum von Mann, zeigte das Foto des Tiers, weinte, und erzählte einen ganzen Abend lang aus dem Leben des Hundes.
„Das war der beste Amigo, den ich im Leben gehabt habe“, sagte Bruno. „Der hat gespürt, was ich denke, und ich habe gewusst, wie er fühlt.“
Nun war er solo und hatte keinen Schimmer, wie es weiter gehen sollte. Er war ein Entwurzelter in seiner Heimat auf der Spree-Bank.
Die meiste Zeit hatte er Hunde als Begleiter gehabt. Er kannte das bedingungslose Verstehen, die vorbehaltlose Zuneigung, die wissenden Blicke.
„Willste keinen neuen?
Bruno sah erstaunt auf: „Nee, ich bin durch damit. Nochmal so was – und das killt mich. Ich bleib’ alleine.“
Sie blickten über den Fluss hinüber zum hellen Hauptbahnhof. Züge fuhren ein und aus, Autos irrlichterten über die Brücke, Menschen hatten es eilig. Von ferne kamen die Geräusche einer Beach-Bar.
„Und weg willste auch nicht?“
„Nee.“ Bruno klang empört. „Ich bin doch nicht der Bayer.“