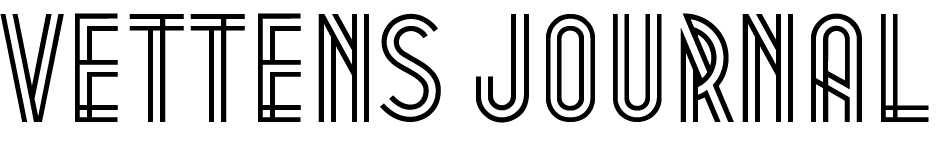DIE NARBE
berlin, 21. mai 2015
Die Jubiläumsfeiern waren im vergangenen Jahr – da hat sich jedermann bemüßigt gefühlt, noch einmal des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Man war tief betroffen darüber, was da vor hundert Jahren über Europa herein gebrochen war. Damit hatte es sich dann aber auch. 2015 gedenkt niemand mehr. Dieser Tage zum Beispiel hat die zweite Flandernschlacht Hundertjähriges – danach kräht kein Hahn.
Wirklich?
Nicht ganz.
Im wunderbaren Wilmersdorfer “Café Horenstein” treffen sich Musikfreunde und wohnen amüsiert einer besonderen Premiere bei. Im Mekka der Schallplatte wird eine CD vorgestellt. Das Horenstein Ensemble hat zusammen mit der Sopranistin Barbara Krieger eine Scheibe mit dem Titel „Verlorene Generation/Lost Generation“ veröffentlicht. Aufgenommen wurden die Werke dreier Komponisten, die zwischen 1914 und 1918 gefallen sind: Rudi Stephan, George Butterworth und Cecil Coles.
Die CD ist ein weiteres Projekt im crossmedialen Abenteuer eines Berliner Journalisten und Fotografen. Martin U. K. Lengemann hat’s erfunden. Titel:
DIE NARBE
Lengemann erzählt die Geschichte seines Urgroßvaters und des Verlaufes der ehemaligen Westfront – es wird eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkriegs. Unter anderem kommen eben auch Komponisten aus Deutschland und Großbritannien zu Gehör, die sehr jung im Ersten Weltkrieg gefallen sind und ihr jugendliches “schon sehr spannendes Schaffen” nicht weiter entwickeln konnten.
“Wissen über den Anderen, über sein Sein und Tun, aber auch über sein Leid und Opfer, machen Versöhnung erst möglich”, sagt Lengemann. “Meinem Ur-Großvater kam diese Erkenntnis bereits mitten in der Schlacht, als er zwischen den Gräben einen britischen Soldaten traf und einen kurzen, kleinen Waffenstillstand schloss. Ihm war verwehrt, sofort Frieden zu schließen – aber seine Geschichte und eine kleine Holzschachtel, machen dieses Projekt überhaupt erst möglich.”

Es ist eine der großen Wunden des Kontinents. Der Berliner Fotograf Martin U.K. Lengemann hat sich auf eine schmerzhafte Spurensuche gemacht.
Da gibt es sie also doch, die Menschen, die die Finger auf die “Narbe” legen, auch wenn es mal kein Jubiläum zu begehen gibt. Es wäre ganz gut, man hörte ihnen zu. In der “Welt am Sonntag” begann Lengemann einen großen Text über sein großes Thema folgendermaßen:
Als mein Urgroßvater starb, war ich fünf Jahre alt. Viele Erinnerungen habe ich nicht an ihn. Johannes Menges war schon sehr alt und saß meistens in seinem Sessel und rauchte Pfeife. Über diesem Sessel hing eine Kuckucksuhr. Ich liebte es, wenn der kleine Vogel zur vollen und halben Stunde erschien.
Wenn ich von meinen Urgroßeltern sprach, nannte ich sie Oma und Opa Kuckuck.
Nur ein Dialog mit meinem Opa ist mir im Gedächtnis geblieben. “Opa, warst du eigentlich im Krieg?”, hatte ich ihn gefragt. Warum ich das fragte? Heute weiß ich es nicht mehr. Was einen kleinen Jungen so umtreibt.
Auch hatte ich sicher keine Ahnung, dass mein Urgroßvater schon zwei Weltkriege erlebt hatte. Ich erinnere mich noch an die lange Pause, die entstand. “Ja”, sagte er.
Ich muss nachgefragt haben, weil er mir dann erzählte, wie er einmal auf einer Patrouille, zwischen den feindlichen Gräben, plötzlich einen englischen Soldaten traf. Die beiden Männer beschlossen, nicht aufeinander zu schießen. Opa sagte: “Wir wollten beide nicht sterben.”
Sie rauchten gemeinsam, in einem Granattrichter sitzend, eine Zigarette. Verständigen konnten sie sich nur schwer, da der eine nicht die Sprache des anderen sprach. Dann ging jeder wieder zu seiner Linie. Am kommenden Tag wurde die Einheit meines Urgroßvaters in Kampfhandlungen verwickelt. Er schoss auf englische Soldaten. Er sagte, er habe sich das nie verziehen, es habe ihm gezeigt, wie grausam Krieg ist.
Meine Oma war fassungslos, als sie von unserem Gespräch erfuhr. Mein Urgroßvater hatte in den 56 Jahren nach Ende des Ersten Weltkriegs ihr gegenüber niemals ein Wort über seine Fronterfahrungen verloren. Warum erzählte er nun einem Fünfjährigen davon?
Wenige Wochen nach meinem Besuch hatte Opa einen Schlaganfall. In der Nacht nach dem Sieg der Deutschen bei der Fußball- Weltmeisterschaft 1974. Oma sagte: “Es war die Aufregung.” Er starb wenig später. Hinterlassen hat
er mir ein paar Karl-May-Bände und einen Sessel.
Vor einigen Jahren gab mir mein Onkel eine kleine Holzschachtel. “Die ist bei dir besser aufgehoben”, sagte er. In dem Kästchen waren Abzeichen, Uniformschulterstücke, das Eiserne Kreuz meines Urgroßvaters und sein Militärpass, der über alle seine Einsätze Auskunft gibt.

“Ihr werdet wieder zu Hause sein, ehe noch das Laub von den Bäumen fällt.” So Wilhelm II. zu den Soldaten, die in den Krieg ziehen.
Der Erste Weltkrieg, diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, hat mich seit Kindheitstagen umgetrieben. Seit mein Onkel in den späten 70er-Jahren in England gearbeitet hatte, ich ihn dort mehrmals besuchte und mich in das Land und die Briten verliebt hatte, war für mich die Versöhnung mit dem ehemaligen Feind ein Lebensthema. Oft dachte ich an die Zigarette zwischen den Frontlinien.
Als Jugendlicher bin ich mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge nach Verdun gefahren, “Versöhnung über den Gräbern”, später mehrmals, um journalistisch in Frankreich über das, was vom Krieg geblieben ist, zu berichten. Jetzt wollte ich zum ersten Mal die ganze Frontlinie mit dem Auto abfahren.
Wie Narben auf einem geschundenen Körper waren und sind die Spuren der Kampfhandlungen von 1914 bis 1918 in Belgien und Frankreich zu sehen. Über 750 Kilometer zieht sich die ehemalige Front von der Schweizer Grenze bis nach Nieuwpoort in Belgien. Marne, Verdun, Champagne, Cambrai, Somme, Ypern.
Experten sagen, man könne noch heute den Frontverlauf auf Satellitenbildern erkennen. 100 Jahre nach Ausbruch der Kampfhandlungen. Es ist die Narbe Europas.
Morgen: Der Seelen-Grenzgang, Teil II