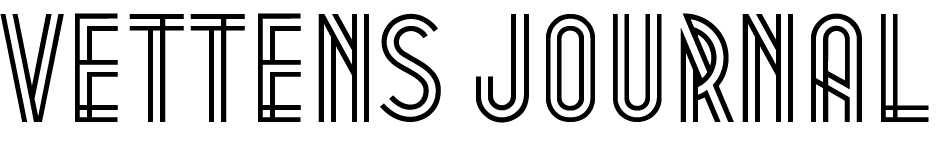DREIGETEILT

berlin/mödlareuth, 3. januar 2015 Übers Vogtland geht der Eiswind, in der Hauptstadt werden die letzten Böller-Reste weg gemacht – und beim ZDF beißt man sich die Nägel, wie denn die Quote für den ersten richtigen Knaller des Jahres ausfallen wird. In einem Dreiteiler soll die Nachkriegszeit aufbereitet werden. Na, dann mal los!
Nach fünf Minuten wird’s volkstümlich in Tannbach. Da stapft der Dorf-Nazi in den Ort, schwenkt einen toten Hasen durchs Bild und wird von seiner besorgten Frau gefragt:
„Franz, wo bist ’n allweil? Moanst ned, mia solltn a bissl mehr achtgebn?“
Er verzieht höhnisch den Mund.
„Mia hom des ned nötig.“
Sie, immer noch nicht beruhigt, mit Blick aufs entleibte Tier:
„Host wieda gwuidat? Im Wald, beim Grafn?“
Schauspieler Alexander Held (der echt fies gucken kann, wenn er will) setzt die böseste Visage auf, die er im Repertoire hat:
„Des is genauso mei Woid.“
Uih, jetzt hat er es denen da oben aber gegeben, den Grafen und denen, die was Besseres sein wollen. Er, der Nazi, fürchtet sich nicht vor ihnen. Er nicht!
Es ist eine Szene wie aus einem Heimatroman des wackeren Ludwig Ganghofer. Urbayerisch. Kraftvoll. Unheil bergend.

Von wegen juche! In Mödlareuth sieht man das Leben grau in grau. / FOTOS: BARBARA VOLKMER
Allein: Das Bayerische passt nicht. Denn Tannbach ist ein fiktiver Weiler an der real existierenden bayerisch-thüringischen Grenze. Da plaudert man fränkisch – und das hat nun gar nichts mit dem g’scherten Held-Bayerisch zu tun.
„Nicht so schlimm“, sagt Gabriela Sperl. Sie hat „Tannbach – Schicksal eines Dorfs“ produziert und entschieden, dass die Schauspieler – wenn ihnen danach ist – so reden sollen, das sie sich in ihrem Idiom wohl fühlen. Klar, man habe an der deutsch-deutschen Grenze nicht oberbayerisch gesprochen – doch das merken letztendlich nur die Menschen aus der Region. Dem Rest der Zuschauer sei das egal.
Was denn der Rest der Zuschauer von einem Dreiteiler wie „Tannbach“ (im ZDF am vierten, fünften und siebten Januar zu sehen) erwartet?
Gabriela Sperl wird sehr lebendig. „Wir holen die Menschen aus einem Raum des Vergessens ab. Sie denken über Dinge nach, die sie verdrängt haben. Viele reden zum ersten Mal über eine Vergangenheit, über die sie sonst schweigen.“
Sie bekommt ja jede Menge Drehbücher ins Büro geschickt. Die meisten legt sie nach kurzer Lektüre weg. „Tannbach“, sagt sie, „hat mich sofort gefangen genommen. Endlich wurde eine Zeit, über die wir nicht viel wissen, aus der Sicht der Opfer erzählt. Und es wurde ein Phänomen erklärt: Da gab es nach einer zufälligen Grenzziehung zwei Seiten – den Osten und den Westen. Und die Autoren kümmern sich um beide Parteien mit der gleichen Sorgfalt.“
Entspannt wirken sie, die Autoren. In ein paar Stunden wird „Tannbach“ den Herrschaften von der Presse vorgestellt – nun ist nichts mehr zu tun als sich Anlass-gerecht einzukleiden und die gute Laune für die Premiere zu konservieren.


Filmszene aus “Tannbach”, dem ZDF-Dreiteiler zum Jahresbeginn
Josephin von Thayental ist die Quirlige, Robert wirkt verhaltener. Man könnte sagen, sie sei eher der Glas-halb-voll-, er wiederum der Glas-halb-leer-Typ.
Im Augenblick sind sie erst einmal erleichtert. Es war ein harter Ritt, den das Autoren-Paar da hingelegt hat. Einmal entwischt Thayental die Vokabel „Burnout-Gefahr“, als er von der Schreibarbeit für „Tannbach“ erzählt.
Zwei Jahre lang hat das Projekt das Denken absorbiert. Josephin und Robert von Thayenthal hatten endlich Grünes Licht für ein Vorhaben nach ihrem Gusto beim ZDF (wo bekanntlich oftmals die Zweifler das letzte Wort haben) bekommen: Sie wollten deutsch-deutsche Historie so aufbereiten, dass der Geschichtsunterricht zum spannenden Erzähl-Dreiteiler wird.

Noch mauerte die DDR. Die Grenze in Mödlareuth im Frühling 1989 vom Westen, fotografiert von A.R. Schaffner / Museum Mödlareuth

Dieter Ackermann besuchte mit den Berufsschülern aus Münchberg “Little Berlin” und fand dann keine Worte der Erklärung.
Die Thayentals zogen sich in ihre Arbeitsräume im Haus bei Innsbruck zurück und schufen ihr Dorf. Das liegt bekanntermaßen irgendwo auf der Grenzlinie zwischen Thüringen und Bayern. Dort leben und kommen zur Welt: Graf und Grafen-Tochter, Einheimische, Heimatlose, Soldaten, Polizisten, Nazi-Schergen, Stasi-Spitzel, Aufrechte, Feiglinge, Liebende, Lügende, überforderte Amis, rüde Russen, Franzosen auf Freiersfüßen, fränkische Luder.
Da werden die letzten Tage von Hitler-Deutschland erzählt. Die Amis und die Russen haben die Waffen und das Sagen, die Menschen müssen sich arrangieren. Die Russen greifen sich den Osten, im Westen schlagen sich die Amis mit den Nazi-Altlasten herum, Deutschland bekommt einen Zaun von der Ostsee bis ans Dreiländereck. Und mittenmang, wo der Zaun entlang führt, liegt ein kleines Dorf. Dort spielt der Film. Drei Abende lang, dreimal eineinhalb Stunden.
„Ambitioniert“ war das Vorhaben der Thayentals, das wissen sie. „Kühnes Unterfangen“ – so raunte man beim ZDF. Da hat es in Mainz eine Menge Leute gegeben, die lieber die Köpfe eingezogen haben.
Derweil zog „Tannbach“ – so nannten die Autoren das Dorf ihrer Phantasie – in ihrem Tiroler Zuhause ein. Die Personen nahmen Gestalt an. Ihre Biographien wurden in Excel-Dateien eingespeist. Lebensläufe miteinander abgeglichen, jede Episode in den historischen Kontext eingebettet.
Sie mussten sich immer wieder zusammen raufen. „Natürlich haben wir auch gestritten.“ Er nickt, fügt bedächtig hinzu: „Wissen Sie, jeder stellt sich die Dinge auf seine Weise vor. Da läuft man nicht immer im Gleichschritt. Wenn es ganz schlimm geworden ist, bin ich auf den Berg gegangen. Das war dann meine Rettung. Wenn ich es recht bedenke: Ich war oft auf dem Berg.“
Josephin nimmt mit ihrem vergnügten Lächeln der Schilderung des Gatten die Dramatik. Dann wird auch sie ernst: „Wir haben ja nicht einfach drauflos erzählt. Bevor wir ans richtige Schreiben gemacht haben, haben wir die Themen definiert, mit denen wir uns beschäftigen wollten. Unser Ziel war, die Entwicklung im Osten und im Westen zwischen 1945 und 1952 so zu schildern, dass keine einseitige Ost- oder Westsicht entsteht. Eine Szene aus dem US-Sektor muss sich nahtlos an eine Episode aus der Zone anschließen. Das sollte wie ein Ping-Pong sein.“
Robert von Thayental kommt aus Graz, Josephin ist Mecklenburgerin. „Wenn Du dann mit dem Partner so ein Drehbuch schreibst, merkst Du erst, welche Lücken Dein Wissen hat.“, sagt sie, er blickt seine Frau interessiert an. „Naja, mit der Rolle Adenauers in dieser Zeit war ich überhaupt nicht vertraut. Das wurde im Geschichtsunterricht der DDR nicht einmal gestreift.“
Einmal waren sie im Kino, „Das Leben der Anderen“ – und erlebten, wie sehr die Ost-West-Trennung auch in ihrer Beziehung noch wabert. Robert war nach der Vorstellung angerührt von der großen Schauspieler-Leistung des Ulrich Mühe, der einen in sich zerrissenen Stasi-Mann verkörpert. „Ich hatte eine Gänsehaut.“
Josephin ihrerseits konnte nur „Pfff!“ machen. Zornig war sie, echt sauer. Da hatte man es wieder einmal: Dass Autorenkollegen sich alle Mühe geben, den Täter ordentlich zu behandeln und ihn verstehen zu wollen. Die Opfer, die Bespitzelten, die um ihr Leben Betrogenen? „Die kommen immer wieder zu kurz.“
Nachdenklich hört von Thayental zu. Ja, sie erlebten Diskussionen und Augenblicke, da mussten sich die Beiden hart an dem Stoff abarbeiten. Es gebe, sagt Robert, noch viele Leerstellen zwischen Ost und West. Er sei betroffen, wenn er mit seiner Frau durch ihre Heimat fahre. Trotz dieser „wunderbaren gewachsenen Städte wie Wismar und Rostock und Schwerin“ gehe in den neuen Ländern die Kultur vor die Hunde, das Gemeinschaftsgefühl der Menschen verliere sich, in den Dörfern gehen buchstäblich die Lichter aus.
„Und die jüngere Geschichte interessiert nicht. Gerade die Jahre nach dem Krieg: Das ist wie ein dicker Nebel. Da wollten wir hinein stochern, damit sich das alles ein bisschen lichtet.“


Neuere Geschichte, das ist ihres: Gabriela Sperl.
Zurück zu Gabriela Sperl, die sich das spielerische Stochern im Nebel zum gut gehenden Geschäft ausgebaut hat. Das Handwerk hat die Diplomatentochter beim Bayerischen Rundfunk als Redakteurin und gelernt, sie hat Drehbücher geschrieben, filmische Großunternehmen produziert. Und vermehrt setzt sie auf Stoffe aus der jüngeren deutschen Geschichte. Gewinnt Preise und Anerkennung mit „Die Flucht“, der Verfilmung der Spiegel-Affäre, einem Projekt über die NSU, „Kinder des Sturms“ oder „Nicht alle waren Mörder“.
Sperl, Jahrgang 1952, ist in der Branche bestens vernetzt und einer dieser Menschen, die eine Nase für Stoffe haben, die die Menschen fesseln. Sie will erzählen, erzählen, erzählen. Schauspieler Michael Berkel beschrieb in einer Laudatio die Produzentin als die „Scheherazade des deutschen Films“ – und im Saal haben alle genickt.
Ein historisches Phänomen wird zu einem Spielfilm – da wendet sich mancher gestandene Geschichtswissenschaftler mit Grausen. Kann doch nicht gut gehen!
Gabriela Sperl fechten die Bedenken solcher Purismus-Kollegen nicht an. Sie hat mit einer 600-Seiten-Abhandlung über Bayerns Industrie und Wirtschaft zwischen 1918 und 1924 („eigentlich war es eine Arbeit über Lobbyismus, der das Land aus der Agrar-Nische geholt hat“) promoviert – sie weiß, wie solides wissenschaftliches Arbeiten geht. Aber sie will keine Werke fürs Regal, sie will ran an die Menschen. „Die Kunst besteht im Verdichten, im Erzeugen empathischer Momente. Sehen Sie: In ,Tannbach‘ wird erzählt, worüber jahrelang geschwiegen worden ist.“
So ein kleines Dorf nach diesem Krieg – was für eine Bühne! Da kann die Produzentin Protagonisten so ganz nach ihrem Geschmack aufmarschieren lassen. „Es gibt die Täter, die aus Überzeugung handeln. Schlimm, wenn die sich moralisch verirren. Es gibt die Opfer. Und es gibt diese Sorte Mensch, die mich immer angeekelt hat. Die Opportunisten – gerade noch sind sie den Hakenkreuzfahnen hinterher gelaufen, und dann helfen sie, das Stasi-System aufzubauen und einen Grenzwall durch ein Land zu ziehen.“
„Tannbach“, so die Produzentin, kümmert sich um die Opfer. „Da haben wir in Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs eine Scheu. Wir trauen uns nicht, die Opfer Opfer zu nennen, weil es diese Schuldgefühle gibt. Aber die Russen waren eben nicht nur die Befreier, es gab da Täter und Unrecht. Das auszusprechen ist heute immer noch politisch unkorrekt.“
Gabriela Sperl ist eine bewunderte, respektierte, gefürchtete Macher-Frau. Sie soll bei Verhandlungen das Letzte aus den Partnern heraus holen. Danach erklärt sie fröhlich, der Film hätte gern noch ein paar 100000 Euro mehr vertragen können, aber was soll’s? Wenn kein Geld mehr im Topf ist, agiert die Sperl nach dem Motto:
„Die Verkleinerung zwingt in die Präzision.“
Sie hat natürlich gut reden. Für Tannbach“ standen Schauspieler aus der ersten Reihe vor der Kamera, und ein paar Junge werden nach diesem Film zu einer bemerkenswerten Karriere durchstarten. 500 Komparsen ließ Frau Sperl anheuern, die Dreharbeiten im tschechischen alimentierten monatelang die Provinz.
„Es ist ein großer Film geworden“, sagt Gabriela Sperl selbstbewusst.
Klar. Viereinhalb Stunden Heim-Kino, wie sie sich das Öffentliche nur zu den Feiertagen leistet.
Natürlich werden sie auch in Mödlareuth einschalten. Schließlich ist der Ort in Thüringen/Oberfranken die Vorlage für „Tannbach“. Der Dorfbach von Mödlareuth wurde zur Zonengrenze. Zuerst war es ein Bretterzaun, dann wurde mit Stacheldraht aufgerüstet, schließlich durchschnitt eine Mauer mit dazugehörigem High-Tech-Grenzstreifen und Beobachtungstürmen die Gemeinde. Menschen aus aller Welt kamen in den Westteil und guckten von kleinen Beobachtungspodesten rüber zu den Kommunisten. Politiker waren auch da und hielten in „Little Berlin“ wohlfeile Reden.
Dieter Ackermann hat an diesem Dezembertag 2014 seine Enkel in den Wagen gepackt und ist mit ihnen nach Mödlareuth gefahren. Er will ihnen zeigen, wie schlimm es in Deutschland mal gewesen ist. So wie er es auch seinen Berufsschülern vor mehr als 25 Jahren gezeigt hat. Da drüben ist der Russ’, der bringt uns noch den Krieg, und, dem Herrgott sei Dank, der Amis steht uns bei, dass es ein Hüben und ein Drüben an der Mauer gibt.
Heute erzählt Ackermann in Mödlareuth also den Enkeln von der bösen alten Zeit, aber sie hören nicht hin. Sie wollen heim, es ist ungemütlich am Grenzstreifen. Leichter Regen geht übers Land, die Mauerreste sind grau, auf dem Grenzstreifen latscht man von einer Pfütze in die nächste.
Zwei junge Männer kommen aus einem windschiefen Haus westlich des Bachs. Sie stoßen mit den halb geleerten Bierflaschen an, lachen sehr laut, steigen in den Wagen und fahren los, in Richtung Hof. Da steppt zwar auch nicht gerade der Bär, aber wenigstens haben ein paar Gaststätten geöffnet.
Hier in Mödlareuth ist nicht mal eine streunende Katze in den Gassen (die alle den Namen „Mödlareuth“ tragen) zu sehen. Die Menschen haben die Vorhänge zugezogen, auch im Gasthof „Grenzgänger“ brennt kein Licht, der Tannbach (er heißt wirklich so) gluckst, der Regen rauscht.
Halt, drüben auf halber Höhe schlurft ein Mann über den Hof, er trägt ein halbes Dutzend Holzscheite auf den Armen. Hat schon vor dem Mauerfall hier den Hof auf Ostgebiet bewirtschaftet.
Damals sind sie sich noch in die Arme gefallen, die Nachbarn aus dem Westen und er.
Dann ist die neue Freiheit übers Land gekommen. „Nein“, sagt er und sieht den Fremden feindselig an. „Mit Euch rede ich nicht mehr.“
„Ihr“ – das sind für die Mödlareuther alle, die nicht aus Mödlareuth kommen. Die immer noch in das Dorf einfallen und sich aufgeilen an der bösen, bösen Mauer, den Gschichterln von NVA und Stasi und scharfen Schäferhunden und Schießbefehl.
„Kein Wort sage ich“, sagt der Mann und lässt anschließend eine Tirade gegen den Rest der Welt los. Zu Hunderten seien sie gekommen, die Typen mit ihren Blöcken und Kameras. Hätten recht schön getan und dann einen rechten Schmarrn in der Zeitung oder im Fernsehen verzapft. „Was über uns gelogen worden ist – das war doch schon ein Verbrechen.“
Das Holz in seinen Armen zittert. Der Bauer ist sehr wütend. Klar hat er gehört, dass jetzt bald ein Film über „Tannbach“ (auch bekannt als Mödlareuth) im Fernsehen läuft. Das Holz zittert noch ein wenig mehr.
Bayerisch kann er nicht wie der Held – aber mindestens so bös’ drein schauen.
„Waaßt, ich soch Dich aans: Uns hat kaans gfrocht, wie’s war. Uns frocht kaans, wie’s uns geht. Mir sen Euch scheißegal. Waaßt Du, wos ich Dir soch: Mödlareuth woar allaweil am Oasch der Welt. Und es bleibt am Oasch der Welt. Mir wolln in kaan Film. Mia wolln nur unser’ Ruh’.“
Er zieht mit einem Krachen die Haustür ins Schloss.
Klappe!